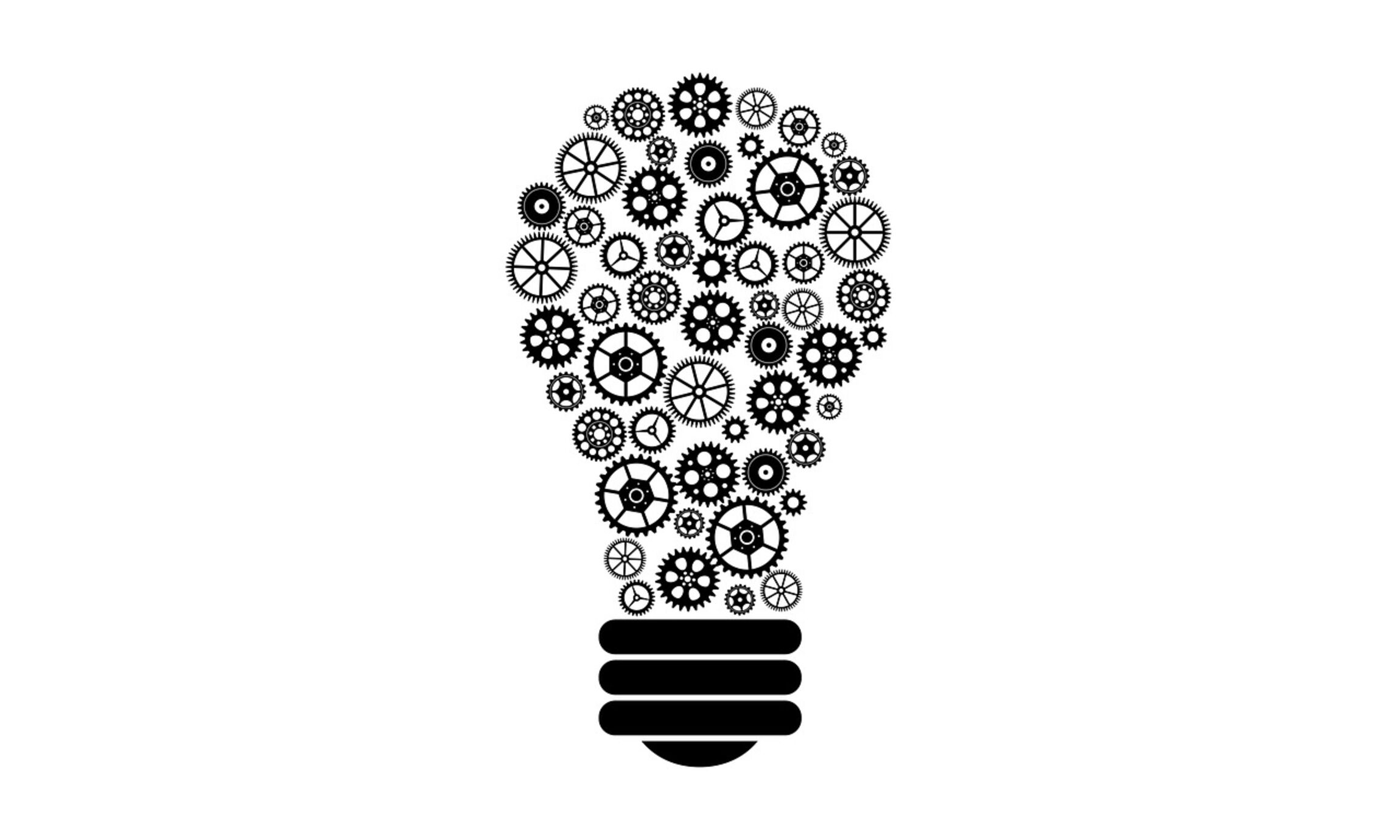Konzeptionelle Überlegungen zur Erweiterung der Kriegerdenkmäler an der St. Nicolai-Kirche durch ein Mahnmal für den Frieden
Die zwei Weltkriege des 20. Jahrhunderts haben im kollektiven Gedächtnis Deutschlands einen tiefen Eindruck hinterlassen. Während im Ersten Weltkrieg nahezu ausschließlich militärische Opfer, d.h. Soldaten beklagt wurden, forderte der Zweite Weltkrieg vorwiegend zivile Opfer.
I. Gedenken am Volkstrauertag im 21. Jahrhundert
Seit langem schon hat der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. den Blickwinkel des Gedenkens am Volkstrauertag geweitet. Es wird nicht mehr nur der „Toten zweier Kriege an den Fronten und in der Heimat“ gedacht, sondern auch der Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen.
Darüber hinaus sind uns aber in den letzten Jahren auch die aktuellen Opfer von Krieg und Gewalt näher gekommen. Nach Auskunft des UNO-Flüchtlingshilfe sind gegenwärtig mehr 60 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht vor Krieg, Konflikten und Verfolgung. Millionen von ihnen haben in Deutschland, auch im Stadtbezirk Bothfeld-Vahrenheide, Schutz gefunden. Zugleich nahmen bestimmte politische Parteien die Flüchtlinge als Anlass, Verteilungsängste zu schüren und so Ressentiments Auftrieb zu geben. In einigen Regionen Deutschlands muss der soziale Friede und der gesellschaftlich-demokratische Zusammenhalt inzwischen als gefährdet betrachtet werden.
Konkret empfiehlt der Volksbund folgenden Wortlaut für das Totengedenken am Volkstrauertag: „Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, an Kinder, Frauen und Männer aller Völker. Wir gedenken der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, der Menschen, die durch Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft, als Vertriebene und Flüchtlinge ihr Leben verloren. Wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden, Teil einer Minderheit waren oder deren Leben wegen einer Krankheit oder Behinderung als lebensunwert bezeichnet wurde. Wir gedenken derer, die ums Leben kamen, weil sie Widerstand gegen Gewaltherrschaft geleistet haben, und derer, die den Tod fanden, weil sie an ihrer Überzeugung oder an ihrem Glauben festhielten. Wir trauern um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, um die Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung, um die Bundeswehrsoldaten und anderen Einsatzkräfte, die im Auslandseinsatz ihr Leben verloren. Wir gedenken heute auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt gegen Fremde und Schwache Opfer geworden sind. Wir trauern mit allen, die Leid tragen um die Toten, und teilen ihren Schmerz.“
Dieser Form des Gedenkens folgt auch das Volkstrauertaggedenken an der St. Nicolai-Kirche. Weiter heißt es im Totengedenken: „Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern, und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der ganzen Welt.“
II. Notwendigkeit der Erweiterung der Kriegsdenkmäler an der St. Nicolai-Kirche
Die Denkmale an der St. Nicolai-Kirche für die gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs und die „Gefallenen und Opfer der Heimat“ des Zweiten Weltkrieges nehmen die genannten Gruppen im Totengedenken nur unzureichend in den Blick:
- Das Gedenken ist ausschließlich vergangenheitsorientiert. Gegenwartsaspekte fehlen völlig.
- Die Formulierung „Zum Gedächtnis der Gefallenen und Opfer der Heimat“ schaut allein auf die deutschen Kriegsopfer – und ist angesichts der tatsächlichen Opferzahlen weltweit als verengt zu betrachten.
- Es werden weder die Kriegsopfer in den von deutschen Soldaten angegriffenen Ländern noch die Opfer des Terrors der nationalsozialistischen Ideologie berücksichtigt.
- Es wird an keiner Stelle zum Frieden und zur Versöhnung unter den Völkern und Menschen gemahnt.
- Die beiden Gedenkstätten befinden sich auf dem ehemaligen Friedhof von St. Nicolai. Zahlreiche alte Grabsteine in unmittelbarer Nähe zu den Denkmälern erinnern daran. Weltkriegsgedenken und Totengedenken vermischen, ohne dass ein Bezug erkennbar ist.
Die Ev.-luth. Landeskirche Hannovers regt an, dass „Denkmäler den heutigen Geist des Strebens nach: Gerechter Friede – Versöhnung – Hass überwinden“ und „nach einer friedlichen, gewaltlosen Welt transportieren sollen.“ Dafür „müssen es manchmal andere sein nach Art, Form und Ausdruck. Wenn die Denkmäler nicht als Mahnzeichen für den Frieden gestaltet und begriffen werden, verlieren sie ihre Funktion für heute, nämlich Steine des Anstoßes zu sein und Mahnung für den Frieden. Wir ermutigen dazu, die Gedenkorte auch künstlerisch neu zu gestalten oder zu kommentieren. Das wir heute anders denken, als es die Gedenkorte vermitteln, muss dauerhaft sichtbar werden. In vielen temporären Ausstellungen, Filmen, Vorträgen … werden die Schrecken der Kriege deutlich. In den Kirchen muss dies dauerhaft Gestalt finden, nur so prägen sie auch spätere Generationen.“
III. Gedanken zur Erweiterung der Kriegsdenkmäler an der St. Nicolai-Kirche
Das Anliegen der Landeskirche haben wir im Sommer 2016 als Kirchenvorstand von St. Nicolai aufgenommen. Es wurde eine Projektgruppe gebildet aus Mitgliedern des Kirchenvorstands und dem Bezirksbürgermeister. Folgende Aspekte sollten bei der Erweiterung der Kriegsdenkmäler berücksichtigt werden:
1. Das Soldatendenkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs und die Steintafel für die Gefallenen und Opfer der Heimat des Zweiten Weltkriegs sind Zeugnisse deutscher Erinnerungskultur. Sie sind zu erhalten und in den erinnerungskulturellen Diskurs zu bringen – zumal mit der jüngeren Generation.
2. Das Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt(herrschaft) weltweit und in heutiger Zeit findet in den beiden Denkmälern keinen Widerhall. Sie stehen genau genommen sogar im Widerspruch zum aktuellen Totengedenken. Es ist darum ein Friedensmahnmal notwendig, das künstlerisch hochwertig ist, um einen würdigen Ort für das Erinnern an die Opfer und für das Mahnen zum Frieden zu schaffen.
3. Ein Friedensmahnmal, das die Kirchengemeinde verantwortet, sollte in seiner Gestaltung für den Bezugspunkt allen christlichen Sehnens und Hoffens nach Frieden anschlussfähig sein. Es sollte darüber hinaus in seiner Ausgestaltung künstlerisch hochwertig und in Größe und Form so gestaltet sein, dass es von vorbeigehenden/-fahrenden Betrachtern wahrgenommen wird. Immerhin führt der Schulweg hunderter Schülerinnen und Schüler täglich an der St. Nicolai-Kirche und seinen Denkmälern vorbei.
4. Das Erinnern an die Opfer von Krieg und Gewalt sowie das Mahnen zum Frieden zwischen den Völkern wie auch innerhalb der Gesellschaft ist auf Kommunikation angelegt. Das Friedensmahnmal soll darum in einer Formensprache gestaltet sein, die die Kommunikation über die Erinnerung sowie über den Weg zum Frieden und zur gewaltfreien Konfliktlösung fördert. Das Ensemble von Friedensmahnmal und Erinnerungsmalen soll so gestaltet sein, dass ein Ort der Begegnung und der Kommunikation entsteht. Dazu ist die vorhandene Grünfläche dergestalt neu zu ordnen, dass die Orte des Gedenken an die Opfer der beiden Weltkriege, des Mahnens zum Frieden und der Totenerinnerung zwar aufeinander bezogen, aber doch auch in ihrer Unterschiedenheit deutlich erkennbar sind.
IV. Erwartungen an das Mahnmal für den Frieden
1. Das Mahnmal für den Frieden dient als Mahnmal der Erinnerung aller Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in gegenwärtiger Zeit.
2. Es dient aber vor allem zur Mahnung zum Frieden und gewaltfreien Konfliktlösung – sowohl unter den Völkern als auch im Stadtteil.
3. Es ist anschlussfähig an den Gedanken, dass Gott und seine frohe Botschaft vom anbrechenden Reich Gottes der Grund allen Hoffens auf einen gerechten Frieden ist.
4. Es regt zum Diskurs an: über die Formen früheren und gegenwärtigen Erinnerns und über mögliche Wege zu einem friedlichen Miteinander.
5. Der Raum, den die Denkmäler und das Mahnmal für den Frieden am Kirchturm gestalten, ermöglicht Kommunikation und Begegnung, u.a. zur Friedensarbeit mit Kindern und Jugendlichen.
6. Das Mahnmal für den Frieden macht die öffentliche Verantwortung der Kirche deutlich für ein zeitgemäßes Erinnern und ein friedlichen Zusammenleben.